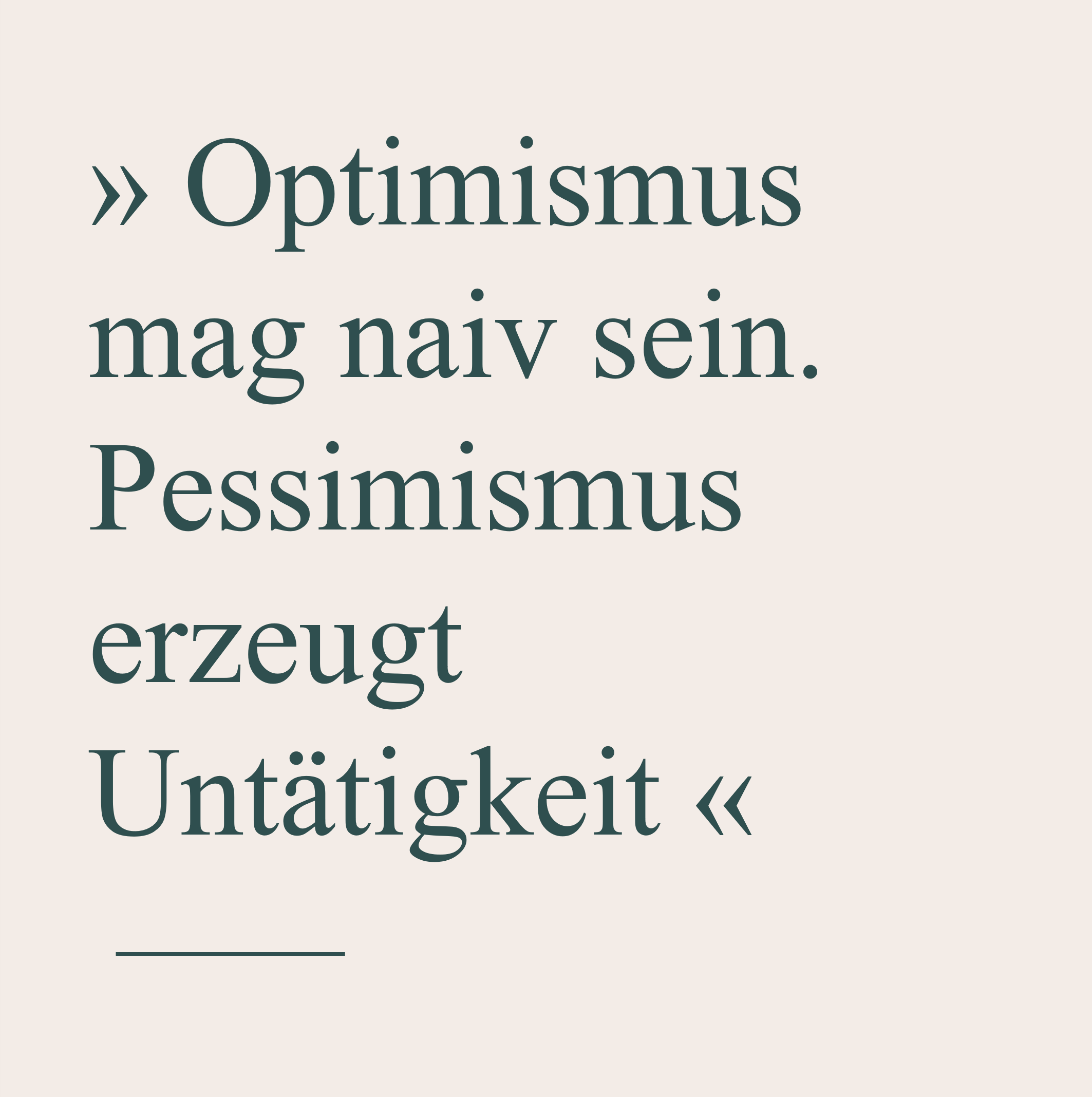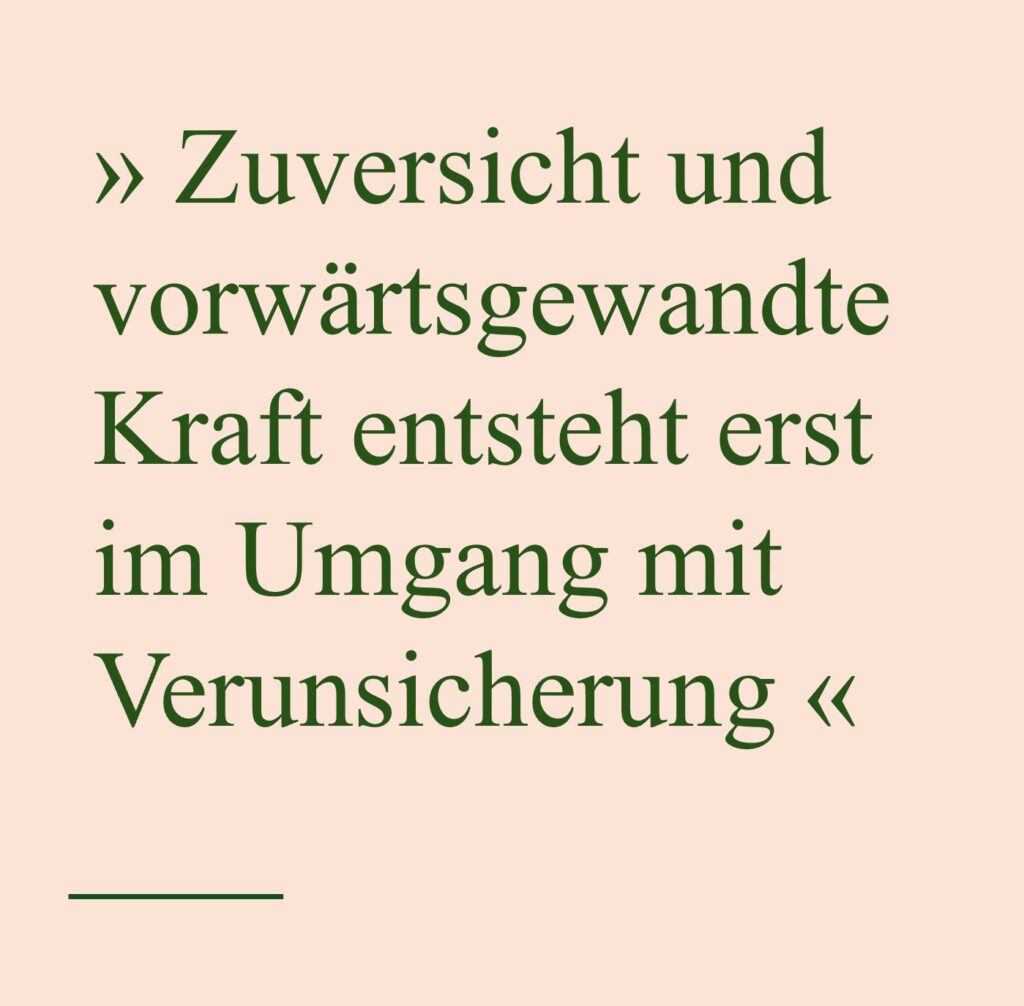
Hallo aus Hamburg,
„Bei all den Newslettern, die ich von Dir gelesen habe, habe ich zum ersten Mal einen Hauch von Resignation gespürt“, rief mir ein treuer Leser nach Lektüre der letzten Ausgabe zu, die sich mit autokratischen Strukturen auf dem Vormarsch befasste. „Wird es Krieg geben?“ fragte mich im Februar eine Kollegin bestürzt, nachdem ich von der Münchener Sicherheitskonferenz zurückkehrte. Dort wurde ich Augenzeuge der Aufkündigung der uneingeschränkten Solidarität der USA mit Europa, die der amerikanische Vizepräsident proklamierte. „Wo geht es mit unserem Unternehmen hin?“ sorgen sich Mitarbeiter angesichts der wirtschaftlichen Lage.
Angst vor Krieg in Europa, autokratische Tendenzen, steigende Lebenshaltungskosten, Arbeitsplätze, die von Wirtschaftskrise und Künstliche Intelligenz bedroht sind: Es sind Zeiten der Verunsicherung, spürbar im Alltag in unseren Unternehmen und Organisationen. Jetzt sind Führungskräfte besonders gefordert: Wir sollen Mut geben, Zuversicht ausstrahlen, Perspektiven eröffnen, obwohl wir oft selbst nicht so genau wissen, wo es hingeht mit dem Unternehmen, uns selbst, der Welt.
Eine häufig anzutreffende Form des Umgangs mit den täglichen Hiobsbotschaften ist, Verbundenheit über gemeinsames Klagen zu erzeugen. „Welche Zölle hat Trump heute schon wieder erhöht? Spinnt der denn?“. „Der Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung taugt nichts für die Lösung der Probleme. Das wird so enden wie die Ampel!“. „Unsere Leute in der Organisation haben die Zeichen der Zeit immer noch nicht verstanden. Was sollen wir denn noch tun?“ Oder der guten alten Zeit hinterher trauern. Sicher, sich gemeinsam aufregen, hilft für den Moment. Eine vorwärtsgewandte Perspektive und Zuversicht gibt das nicht. Im Gegenteil: „Das Beharren auf den eigenen Empfindungen von Verlust (und Ratlosigkeit, ergänzt von mir) ist eine selbsterteilte Erlaubnis für wehleidige Selbstgerechtigkeit.“ Und ein praktisches Instrument, sich den Verhältnisse nicht zu stellen, wie der Historiker Valentin Groebner neulich treffend beschrieben hat. Wollen wir uns jetzt noch vier Jahre lang über die tägliche Kakophonie aus Washington aufregen? Und glauben wir im Ernst, dass im Wesentlichen der Staat die Herausforderungen lösen kann, die wir an allen Ecken und Enden haben?
Es sind vielmehr die keineswegs neuen Gebote guter Führung, die weiterhelfen. Zuhören. Den sorgenvollen Gedanken, auch den eigenen, Raum geben. Konkreter nachfragen: Wie geht es euch mit der derzeitigen Situation im Unternehmen, in der Stadt, im Land? Was bedrängt euch? Sich auszusprechen hilft und signalisiert: Du bist nicht allein mit Deinen Sorgen. Mehr denn je kommt es darauf an, eine Umgebung psychologischer Sicherheit zu schaffen: ehrlich sagen zu können, wie es einem geht, ohne Nachteile befürchten zu müssen. Zusammenhalt durch gemeinsames Tun schaffen: ein wöchentliches Frühstück organisieren. Eine Spendenaktion für die zivilen Opfer des Kriegs in der Ukraine starten. Foren von bis zu acht Führungskräften schaffen, in denen diese sich vertraulich über ihre alltäglichen Herausforderungen austauschen und Tipps teilen.
Es kommt jetzt darauf an, dem erratischen Aktionismus, den die Nachrichtenlage täglich transportiert, kühlen Kopf und einen längerfristigen Blick entgegen zu setzen. Darauf hinweisen, dass wir als Unternehmen die Herausforderungen der Krise zum Anlass nehmen, um zukunftsfähiger zu werden. Künstliche Intelligenz nutzen und Arbeitsprozesse, die uns seit langem nerven, vereinfachen: in der Buchhaltung, bei Datenanalysen, Präsentationen, Terminkoordinationen und Reisebuchungen. Wege in die Zukunft erklären: Wir kürzen das Budget X, um im Zukunftsfeld Y handlungsfähig zu bleiben. Sich endlich vom Produkt Z, dem Geschäftsfeld A und der lange defizitären Niederlassung im Land X trennen. Eine aktuelle Gallup Studie zeigt, dass Hoffnung das wichtigste Bedürfnis ist, was Mitarbeiter jetzt von ihren Führungskräften erwarten – noch vor Vertrauen, Mitgefühl und Stabilität.
Als der amerikanische Vizepräsident seine eingangs erwähnte Abgrenzungsrede zu Europa Mitte Februar im Bayerischen Hof beendete, war es im Raum eisig. Ich ging in wenigen Sekunden durch vier Gefühlszustände: sich einmal schütteln, Erleichterung („Endlich haben wir es verstanden!“), aus Trotz erwachsener Mut („Jetzt erst recht!“) und Zuversicht („Wir werden das schaffen!“). Krisen tragen Gestaltungsmöglichkeiten in sich. Endlich sind wir in Europa dazu gezwungen, auf unserem Wertekodex wirtschaftliche, technologische und sicherheitspolitische Eigenständigkeit zu errichten. In Berlin formiert sich gerade eine starke Strömung in der Tech-Start-up Szene, die sich von der traditionellen Fixiertheit auf die USA ab- und sich Europa zuwendet.
Vielleicht braucht es erst Verunsicherung, damit echte, ansteckende Zuversicht und wirkungsvolle Kraft möglich wird. Da stehen wir jetzt. Wie gut!