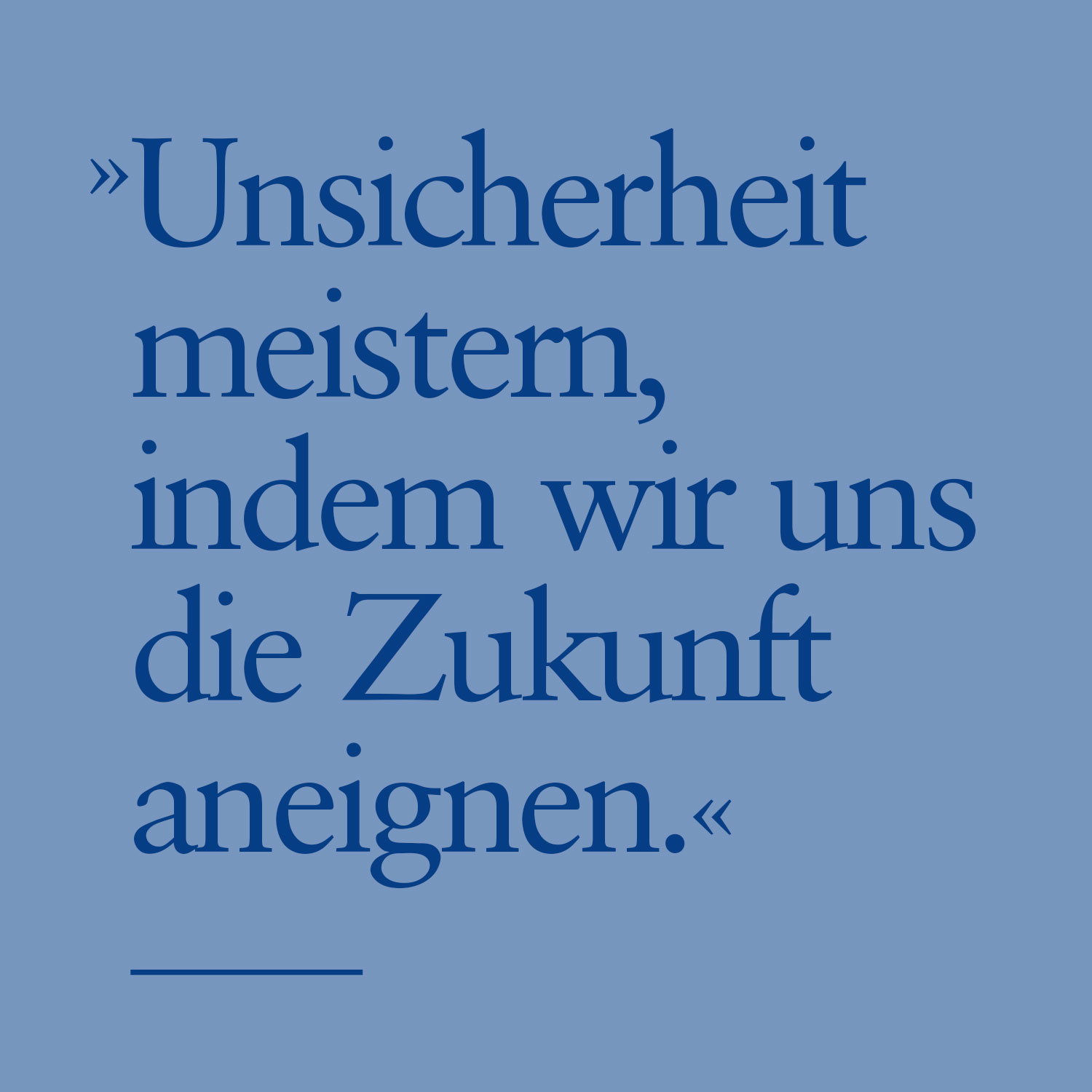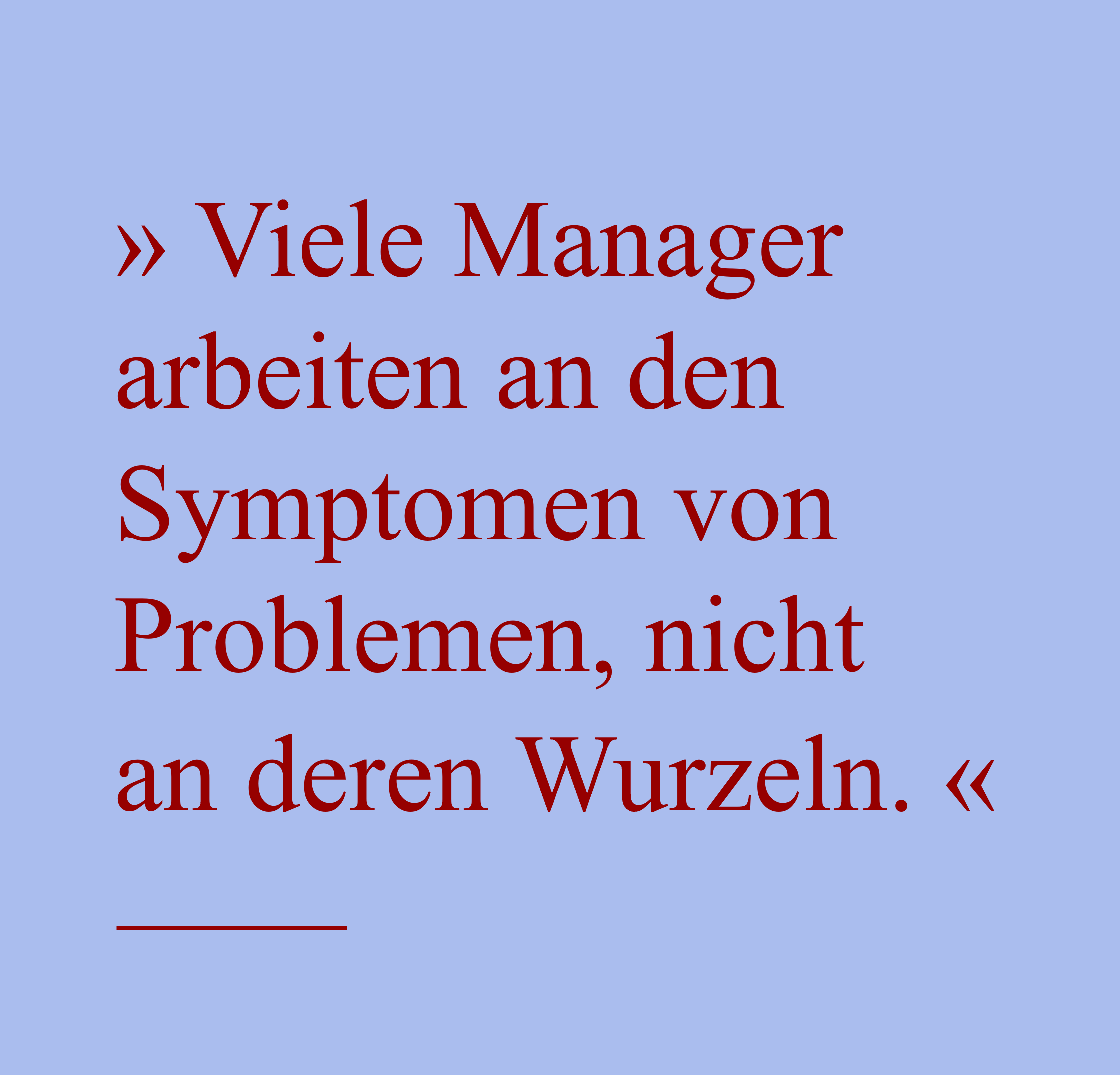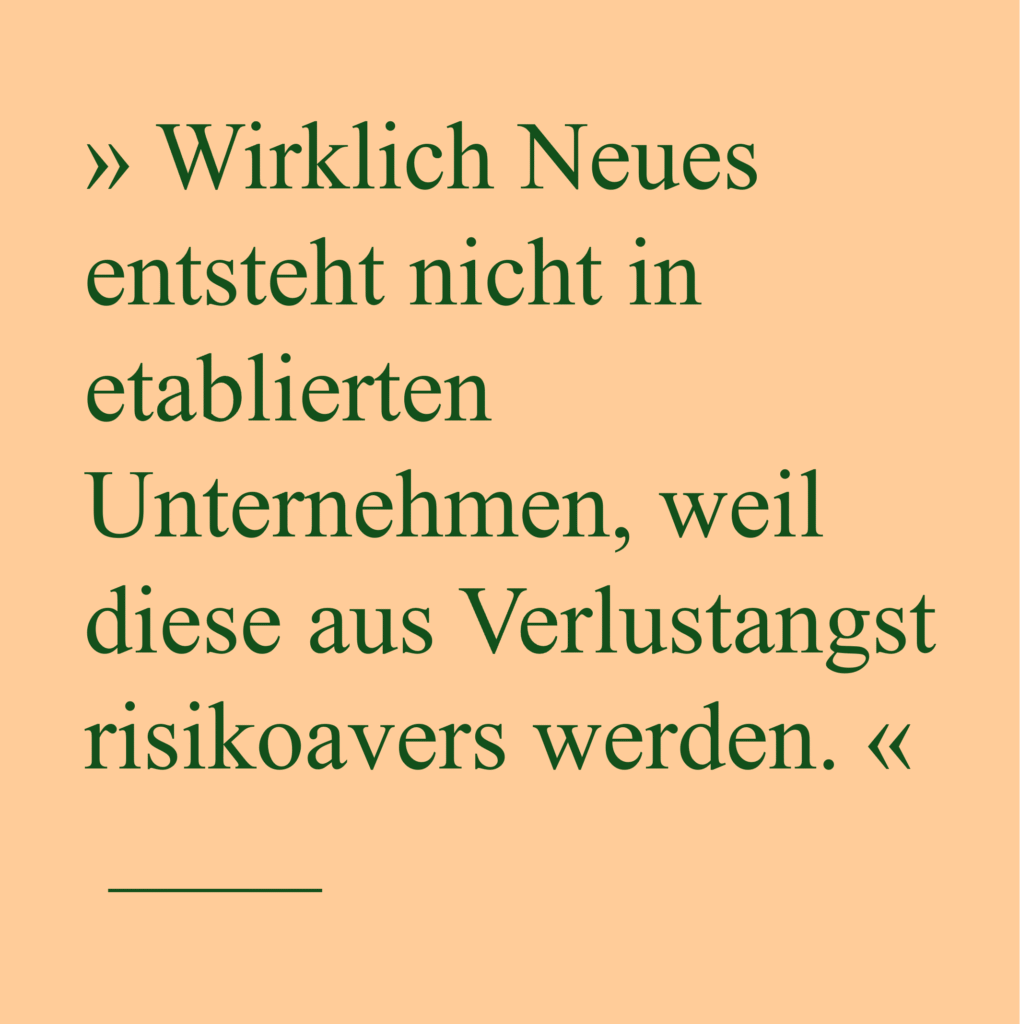
Hallo aus Hamburg,
je unberechenbarer die Zeiten, desto lauter wird der Ruf nach zentralisierten Prozessen und effizienten Strukturen, die Planbarkeit und Wachstum sichern sollen. Diese Reflexreaktion auf Unsicherheit beobachte ich zurzeit in vielen Unternehmen. Jeden Stein umdrehen, sich von unrentablen Geschäftsfeldern und Vertriebsregionen trennen, seit langem anstehende Personalentscheidungen umsetzen, den After Sales Bereich endlich so aufstellen, dass er das Margenpotenzial bringt, das er in sich trägt – der äußere Druck hilft, Sachen zu erledigen, die wir lange vor uns hergeschoben haben. Es ist die Zeit des Aufräumens, Ordnens und Fokussierens.
Fortschritt und nachhaltiges Wachstum entstehen dadurch allerdings nicht, weder für das einzelne Unternehmen noch für die Volkswirtschaft als Ganzes. Oder besser: nur so lange, bis das Potenzial einer bestehenden Geschäftsmodelllogik oder Technologie ausgeschöpft ist. Darauf hat der Wirtschaftshistoriker Carl Benedikt Frey in einem gerade erschienenen und lesenswerten Buch „Wie Fortschritt endet“ hingewiesen und erklärt, warum technologische Entwicklung immer wieder stockt und dann plötzlich wieder Fahrt aufnimmt. Sein Fazit: Wachstum und Fortschritt brauchen Unordnung und entstehen im Spannungsfeld von Chaos und Struktur, von Dezentralität und Zentralität. Innovationen brauchen Freiräume, oft chaotische Orte des Austauschs und Experiments. Saloons im Wilden Westen, Kaffeehäuser im 20. Jahrhundert, vielfältige Universitätslandschaften, interdisziplinäre Netzwerke – das waren und sind Brutstätten für Neues. Rigide Planwirtschaft und überregulierte Systeme führen selten zu echten Innovationen. Die sowjetische Wissenschaft hatte viele kluge Köpfe, aber keine bahnbrechenden neuen Erfindungen hervorgebracht.
Der Wirtschaftsnobelpreisträger Daron Acemoğlu zieht die Analogie zu Unternehmen: Unternehmen, die Neues entwickeln, setzen zunächst auf dezentrale Entscheidungsstrukturen um zu explorieren. Wenn eine Idee tragfähig wird, braucht es zentrale Strukturen, um sie effizient zu skalieren. Ein Beispiel dafür ist die Technologisierung von Transport (Eisenbahn) und Bergbau dank der Dampfmaschine. Der Motor der Industrialisierung startete zwar in der Mitte des 19. Jahrhunderts in Großbritannien. Strukturiert und skaliert wurden die daraus entstehenden Geschäftsmodelle 20 Jahre später im wilhelminischen Deutschland, was die Grundlage für den großen wirtschaftlichen Erfolg Deutschlands im Berg-, Maschinen- und Autobau und das Wirtschaftswunder nach dem Zweiten Weltkrieg bildete. Ein ähnliches Muster zeigt sich bei der Erfindung der mRNA-Technologie. Jahrzehntelang wurde geforscht, ohne klare Anwendung. Erst mit COVID-19 wurde aus einem wissenschaftlichen Flickenteppich ein skalierbares Produkt – dank der Zusammenarbeit von BioNTech mit dem Pharmariesen Pfizer. Wirklich Neues entsteht selten in etablierten Unternehmen, weil diese aus Verlustangst risikoavers werden.Google hatte 2017 seinen Kodak Moment. Der Tech Riese hatte die Transformer Architektur entwickelt, künstliche neuronale Netzwerke, die heute Basis für alle großen Sprachmodelle der Künstlichen Intelligenz sind. Aus Angst, das bestehende Geschäftsmodell zu gefährden, hat das Unternehmen diese Entdeckung damals nicht in den Markt gebracht. Erst eine kleine, agile Organisation namens OpenAI machte daraus eine Technologie mit der schnellsten Marktdurchdringung eines Produkts aller Zeiten.
Die „Phasenlogik“ aus dezentralem Chaos und zentraler Ordnung erklärt auch, warum im Moment so viele verschiedene KI-Modelle und Start-ups entstehen, die auf Basis von OpenAI-Technologie neue Anwendungsfelder erschließen. Wer den Überblick verliert, sollte sich trösten: In „Zwischenzeiten“ ist Vielfalt ein Zeichen für Lebendigkeit und notwendige Unordnung auf dem Weg zu neuem Fortschritt. Der Wirtschaftsjournalist Martin Wolf sieht in dieser Innovationsfähigkeit offener Systeme übrigens einen der Gründe, warum sich die Weltwirtschaft trotz der gegenwärtigen Krisen zurzeit noch erstaunlich robust zeigt, wie er kürzlich in der Financial Times ausgeführt hat.
„Seit 2019 haben wir keine Innovation mehr hervorgebracht. Stattdessen haben wir darüber immer wieder diskutiert, ohne voranzukommen.“ – so die Aussage von Führungskräften eines produzierenden Unternehmens dieser Tage. Jetzt, wo es enger wird, können wir es uns nicht mehr leisten, nichts Neues in den Markt zu bringen. Und das während wir gleichzeitig aufräumen. Kein leichter Spagat.
Wie erlebt Ihr das Spannungsfeld zwischen Fokussierung und Öffnung für Neues in Euren Unternehmen?
Schreibt mir gerne
Herzliche Grüße
Markus Baumanns